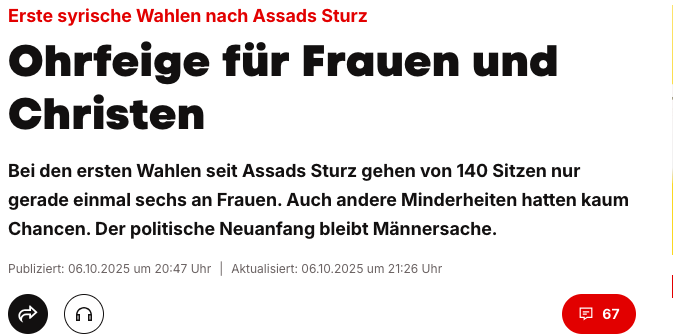Haarsträubend: «Frauen und andere Minderheiten»
Neustes Beispiel: Nach der Parlamentswahl in Syrien gingen 6 von 140 Sitzen an Frauen – ganze vier Prozent. Und das bei einem Bevölkerungsanteil von fünfzig Prozent. Wer Frauen unter diesen Umständen als «Minderheit» bezeichnet, hat entweder den Taschenrechner verloren oder den Blick auf die Realität.
Sprachliches Feigenblatt
Die Phrase «Frauen und andere Minderheiten» macht aus einem strukturellen Problem ein sprachliches Feigenblatt: Die Dimension der Untervertretung wird verwässert, der Skandal kleingeschrieben. Wenn die Hälfte der Bevölkerung sich mit vier Prozent der Sitze begnügen muss, ist das keine Randnotiz, sondern ein demokratisches Armutszeugnis.
Weitere Beispiele
Es fällt auf, dass Medienschaffende Frauen immer mal wieder mit «anderen Minderheiten» in einen Topf werfen:
- Die Online-Zeitung «Bajour» kritisierte kürzlich, dass «Frauen und andere Minderheiten» sich immer wieder Räume im öffentlichen Raum suchen müssen.
- Die «Südthüringer Zeitung» zitierte ohne mit den Wimpern zu zucken eine Fachfrau, wonach die Digitalisierung der Gesellschaft Gewalt gegen «Frauen und andere Minderheiten» fördere.
- Der «Tagesanzeiger» berichtete von einem Büro in Kalifornien, das dafür sorgt, dass bei der Feuerwehr genügend «Schwarze, Frauen und andere Minderheiten» arbeiten.
- Gemäss der Boulveard-Zeitung «Blick» sieht sich eine Band mit einer Unterrepräsentation von «Frauen und anderen Minderheiten» konfrontiert.
- Der «Nebelspalter» berichtete von einem Projekt, das die Klimaresistenz von «Frauen und anderen Minderheiten» in Asien fördern soll.
- Der öffentlich-rechtliche Sender SRF paraphrasierte die Aussagen von Aktivistinnen, denen zufolge der nationale Frauenstreik nötig sei, um auf die Anliegen von «Frauen und anderen Minderheiten» aufmerksam zu machen.